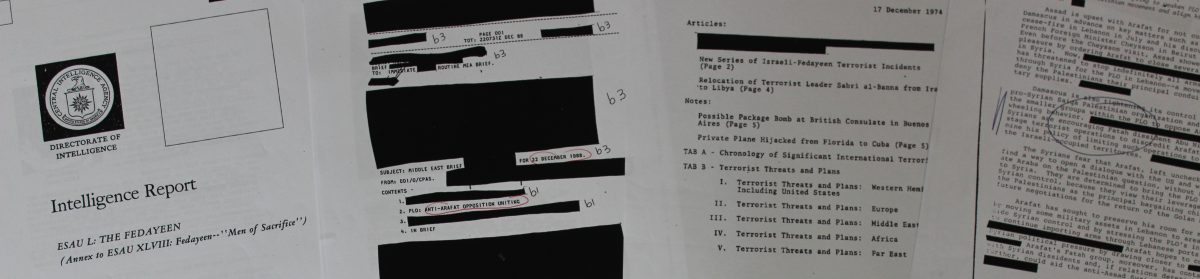Vor 35 Jahren, am 19 Mai 1989, kam es zu einem rätselhaften Bombenanschlag auf der Wiener Flughafenautobahn. Rückblickend wurde spekuliert, es könnte sich gar um eine Art Probesprengung gehandelt haben – als Vorbereitung für das Attentat der Roten Armee Fraktion (RAF) auf den Deutsche Bank-Vorstandssprecher Alfred Herrhausen. Dieses fand nur wenige Monate nach der Explosion in Wien statt. Jahrzehnte später lässt sich ausschließen, dass diese beide Ereignisse etwas miteinander zu tun hatten.
An jenem 19. Mai 1989 war Mido F. gegen 08.30 Uhr stadteinwärts auf der Wiener Flughafenautobahn A4 unterwegs: „Plötzlich hörte ich einen heftigen Knall, das Fahrzeug wurde an der rechten Vorderseite teilweise hochgehoben und die Windschutzscheibe zerbarst. Was genau geschehen war, kann ich nicht angeben.“
Zeitgleich passierte Herbert K. die Stelle, als sich neben der Leitschiene die Detonation ereignete: „Durch den Luftdruck wurde der vor meinem Fahrzeug fahrende Lkw teilweise hochgehoben sowie ein weiterer Pkw […] seitlich nach links versetzt. Bei dem Vorfall wurden Erdmassen (Erde, Steine, Sand etc.) ca. 20 m in die Luft geschleudert und blieben auf den Fahrstreifen der A4 liegen.“ Auch der Fahrer des Lkws, Ljubisa K., kam mit dem Schrecken davon. Was war passiert?
Ungefähr 250 Meter nach der Schrägseilbrücke über die Donau war auf der rechten Straßenseite eine „unkonventionelle Sprengvorrichtung“ explodiert, „wie sie vorwiegend von terroristischen Gruppen zur Verübung eines Sprengstoffanschlages verwendet wird“. Das war der Befund der beiden Sachverständigen vom Dokumentationszentrum Sprengstoffanschläge, dem heutigen Entschärfungsdienst. Einer von ihnen, Ernst Huber, hatte erst 1987 die Leitung des kleinen Teams übernommen.

Huber und sein Kollege fanden heraus, dass eine blaue Propangasfalsche als Sprengstoffbehälter fungiert hatte. Diese war mit einer Mischung von ca. 33,3 kg Natriumchlorat (auch Unkraut-Ex genannt) und Staubzucker als Kohlenstoffkomponente befüllt worden. Die Zündauslösung erfolgte per Funkfernsteuerung mit der eine „maximale Reichweite von ca. 1.000 m zu erzielen ist“. Die Ermittler vermuteten, dass von einem Wasserturm in der näheren Umgebung aus der Schalter umgelegt worden war. Der Aussichtspunkt bot einen Überblick über das gesamte Geschehen.
Die Explosion hatte einen 4,5 Meter breiten und 1,6 Meter tiefen Krater hinterlassen. Metallsplitter waren in einem Radius von 55,6 Meter weggeschleudert worden. Diese Splitter „stellen eine enorme Gefahr für Personen dar, die sich im Splitterwurfbereich befinden“. Aber die Sprengwirkung war durch die Böschungskante primär nach unten und hinten in die Felder abgelenkt worden.
Deshalb war auch der Sachschaden relativ gering: „Im unmittelbaren Bereich des Explosionskraters war eine starke Deformierung der Leitschiene sowie eine Beschädigung der in 11 m Höhe angebrachten Straßenleuchte feststellbar. Eine Beschädigung der Fahrbahn selbst war nicht ersichtlich“, heißt es im Gutachten der Ermittler.

Laien waren hier nicht am Werk gewesen: „Die einzelnen Teile der funkferngesteuerten Zündvorrichtung warne fachgerecht zusammengesetzt, was darauf schließen lässt, dass der oder die Täter Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektronik bzw. dem Anwendungsbereich einer Funkfernsteuerung haben müssen.“ Auch für die Herstellung der Eigenbau-Bombe war „entsprechendes einschlägiges Fachwissen erforderlich“.

35 Jahre später ist der Anschlag auf der Flughafenautobahn völlig in Vergessenheit geraten. Obwohl es sich beim Ziel um eine wichtige Verkehrsinfrastruktur gehandelt hatte, finden sich weder im Polizei- noch im Staatsarchiv Unterlagen. Gerade einmal die Akten der Sachverständigen sind im öffentlich nicht zugänglichen Archiv des Entschärfungsdiensts noch vorhanden.
Huber ist von dem Fall bis heute fasziniert. Außergewöhnlich war es für ihn insofern, „weil es ziemlich zu Beginn meiner Laufbahn passiert ist. Von der Wirkung her war es einer größten Anschläge, die wir bis zum damaligen Zeitpunkt in Österreich gehabt haben. Der tiefe Krater hat darauf hingewiesen, dass eine ziemliche Menge an Sprengstoff detoniert ist. Es war auch eine der ersten Fälle, wo in Österreich Funkfernsteuerungen zur Auslösung verwendet wurden. Das war das interessante dabei. Allerdings konnten dem ganzen kein eigentliches Ziel zuordnen. Was sollte damit gemeint sein?“

Wenige Monate nach der Explosion auf der Flughafenautobahn, am 30. November 1989, kam es in der Nähe von Frankfurt am Main zu einem Attentat. Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, geriet in eine Sprengfalle. Als sein Auto eine kurz vorher aktivierte Lichtschranke detonierten sieben Kilogramm TNT, die auf dem Gepäckträger eines Fahrrads befestigt waren. Die Sprengladung war mit einer nach innen gewölbten und zwei Kilogramm schweren Kupferplatte abgedeckt. Der Explosionsdruck und die extreme Hitze schmolzen das Kupfer dann zu einem Karotten-förmigen Geschoss. Dieses durchschlug mit enormer Geschwindigkeit Herrhausens gepanzerten Mercedes 500. Die verheerende Wirkung war zentimetergenau berechnet worden, sodass der Spitzenbanker tödlich verletzt wurde, sein Fahrer aber „nur“ mit dem Schrecken davonkam.
Die Rote Armee Fraktion (RAF) bekannte sich mit einem dünnen Papier. Gleichzeitig deutete nichts darauf hin, dass die linksextremen Terroristen zu einem solchen Schlag in der Lage gewesen wären, den es bis dato in Westeuropa noch nie gegeben hatte. Die verwendete Sprengtechnik verwies auf den Libanon, wo die RAF traditionell eng mit palästinensischen Gruppen kooperierte. Verdächtigt werden bis heute aber auch Elemente der DDR-Staatssicherheit und sogar der KGB.
„Herrhausen-Attentat bei Wien getestet“
Zur präzisen Umsetzung des Anschlags waren Simulationen notwendig gewesen. Es wurde vermutet, dass diese im Ausland stattgefunden hatten, um nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Ein Bericht im „Kurier“ am 15. Dezember 1989 stellte zur Diskussion, ob das „Herrhausen-Attentat bei Wien getestet“ worden sei. Ein Mitglied der deutschen Sonderkommission wurde folgendermaßen zitiert: „Der Zündmechanismus der späteren Höllenmaschine wurde im Ausland getestet. Man wollte bei dem Anschlag gegen den ‚Herrn des Geldes‘ sichergehen, dass Herrhausens gepanzerter Mercedes in die Bombenfalle fährt.“ Hatte der im Augenblick der Explosion auf der Flughafenautobahn vorbeifahrende Lkw für die 2,8 Tonnen schwere Limousine Herrhausens gestanden?
Tatsächlich gab es auf den ersten Blick spannende Parallelen. So ereigneten sich beide Detonationen von der Tageszeit her nur fünf Minuten nacheinander. Herrhausen Fahrzeug war um 08.34 Uhr in die Sprengfalle geraten – in Wien wurde die Bombe um 08.29 Uhr gezündet. Die deutschen Autoren Gerhard Wisnewski, Wolfgang Landgraeber, Ekkehard Sieker griffen diese Spur 1992 für ihr Buch „Das RAF-Phantom“ (1992) auf. Aber zu diesem Zeitpunkt war der „Fall Wien“ bereits zu den Akten gelegt. Nur hinter vorgehaltener Hand seien Wiener Sicherheitsbeamte „nach wie vor davon überzeugt“, dass beide Sprengungen „etwas miteinander zu tun hatten“. Nur reden wollte darüber angeblich niemand.
Eine der ersten Anlaufstellen für Anfragen vom deutschen Bundeskriminalamt in Sachen Herrhausen wäre das Dokumentationszentrum für Sprengstoffanschläge gewesen. Huber kann sich jedoch an keinerlei Austausch diesbezüglich erinnern. Im Gespräch mit dem Autor gibt er an: „Wir hatten mit dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden relativ viel Kontakt und waren dort oft für Tagungen und Kurse. Da ist der Herrhausen-Anschlag besprochen worden. Das war eine komplett andere Sprengtechnik als bei der Explosion an der Flughafenautobahn. Bei Herrhausen ist das in den militärischen Bereich hineingegangen.“ Eine völlig andere Kragenweite.
Die linke Spur
Die Flughafenautobahn-Bombe lud auch deswegen zu Spekulationen ein, weil es kein Bekennerschreiben gegeben hatte. Unmittelbar nach der Tat vermutete man einen Zusammenhang zu einer vorangegangenen Serie kleinerer Anschläge, die der heimischen linksextremistischen Szene zugeordnet wurden:
Am 1. Oktober 1988 war beim fertiggestellten Polizeigebäude am Franz-Josefs-Bahnhof ebenfalls eine Propangasflasche per Zeitzünder in die Luft gejagt worden.
Am 20. April 1989 wurde auf einer Baustelle der Firma H. in Wien-Simmering ein mit vier Kilo Sprengstoff versehener Druckkochtopf sichergestellt. Der Zeitzünder hatte versagt.
In zwei weiteren Fällen wurde Sprengpulver in Doppelliterflaschen bei H.-Kräne abgestellt. Eine detonierte, die andere brannte „nur“ ab. Der „Kurier“ berichtete: „In keinem der Fälle kam die Polizei den Tätern auf die Schliche. Eine Spur zur Anarchoszene blieb ebenfalls kalt.“
Die Firma H. hatte nämlich zuvor von Autonomen besetzte Häuser in der Wiener Aegidigasse geschliffen. Huber winkt auch an dieser Stelle ab: „Es gab einige Vorfälle, die dem linksextremen Spektrum zuzurechnen waren.“ Aber ein Zusammenhang mit der Flughafenautobahnbombe wurde nie hergestellt: „Das was etwas komplett Separates.“
„Ein Spass“
Tatsächlich ging der Fall weder auf das Konto internationaler Terroristen noch hatte die RAF etwas damit zu tun. So überraschend es im ersten Moment klingt, die Bombe wurde mutmaßlich von einem Millionärssohn und zwei Helfern gelegt. Hintergrund war ein Zerwürfnis innerhalb der Familie des Hauptprotagonisten.
Knapp ein Jahr nach der Explosion auf der Flughafenautobahn kam Bewegung in den Fall. Huber erinnert sich. Der Millionärssohn habe einen Auftragskiller damit betraut, seine Eltern zu ermorden: „Aber dem war die Sache zu heiß und er ist zur Polizei gegangen und hat das gemeldet. Er hatte schon die Hälfte des Geldes erhalten. Den Rest hätte es bei Erledigung gegeben. Dazu ist es aber nie gekommen.“
Am 15. und 16. Mai 1990 kam es zu drei Hausdurchsuchungen in Wien. Bei einem der Komplizen wurde unter anderem ein Funksteuersender Multiplex Professional FM7 samt dazu passender Empfangsanlage sichergestellt, die im Modellbau für die Fernsteuerung von Flug- und Fahrzeugmodellen verwendet werden. Diese Geräte können jedoch „auch in terroristischen Kreisen für die funkferngesteuerte Zündauslösung von Spreng- und Brandvorrichtungen eingesetzt“ werden, heißt es in dem Befund der Sachverständigen. Außerdem fand sich eine Zeitschaltvorrichtung
Anhand der Sicherstellungen schloss sich der Kreis zur Flughafenautobahn-Bombe, aber nicht nur: Am 4. Juli 1988 war auf ein Firmenfahrzeug in der Modecenterstraße ein Brandanschlag verübt worden. Huber erinnert sich, dass unter dem Kotflügel ein Gipsbehälter angebracht worden war, der mit Blitzlichtpulver gefüllt war: „Als der Lenker angestartet hat, ist das Blitzlichtpulver explodiert. Wir haben diese Vorrichtung dann mit einem Wassergewehr heruntergeschossen. Damals haben wir die Hintergründe nicht gewusst. Aber das dürfte auch schon eine solche Probesprengung gewesen sein.“
Es stellte sich heraus, dass die bei dem Brandanschlag verwendete und die bei den Hausdurchsuchungen sichergestellten Funkfernzündungen „völlig äquivalente Bauteile aus dem Modellbau“ enthielten. Dasselbe galt für den Sprengstoffanschlag auf die Flughafenautobahn, jedoch trugen die Bauteile eine andere Typenbezeichnung. Dafür wurde die Kabelverbindung zwischen den Vorrichtungen in allen Fällen mit einem Isolierband in gleicher Farbe (Violett) ausgeführt.
Eine wichtige Stelle im Befund der Sachverständigen lautet: „Sowohl beim Brandanschlag am 04.07.1988 auf einen PKW der Firma […] als auch beim Sprengstoffanschlag am 19.05.1989 auf der Flughafenautobahn A4 kamen laut seinerzeitiger kriminaltechnischer Untersuchung sogenannte ‚Selbstlaborate‘ in Form einer Kaliumchlorat, Schwefel, Zinkmischung und einem Selbstlaborat, bestehend aus Natriumchlorat (kommerziell als ‚Unkraut-Ex‘ bezeichnet) und einer organischen Substanz, zumeist findet Staubzucker dafür Verwendung, zum Einsatz.“
In Bezug auf alle drei Verdächtigen konnte „mit Sicherheit angenommen werden, dass sie Kenntnisse auf dem Gebiet selbsthergestellter Sprengstoffe besitzen“. Einer aus dem Trio stach in dieser Hinsicht besonders hervor: „Er war im Jagdkommando tätig oder ist aus dieser Richtung gekommen.“ Der Mann habe sich für Funkfernsteuerungen interessiert, „hat diese für […] gebaut und die haben dann auch funktioniert. Die sichergestellte Funkfernsteuerung hatte genau den gleichen Aufbau und die gleichen Teile drin“, so Huber.
Nur in Sachen Motiv kam man nicht weiter. Huber vermutet, die Flughafenautobahnbombe wäre letztlich „ein Spaß“ gewesen – „um zu sehen, wie so etwas funktioniert. Gegen was sich die Explosion genau gerichtet hat, hat man nie sagen können. An der Stelle sind viele Autos zufällig vorbeigefahren. Die Druckwelle hat ein paar Fahrzeuge verschoben. Es gab aber keine Verletzten durch Splitter.“
Das – so Huber – war reiner Zufall: „Die Ladung war hinter der Leitschiene in der Böschung deponiert. Diese topografische Kante hat dazu beigetragen, dass sich die Druckwelle nicht so stark gegen die Fahrbahn richtete, sondern nach unten, in Richtung Freudenau. Dort waren dann auch die ganzen Trümmer des Auslösesystems verstreut. Die Täter haben jedenfalls vorher nicht beurteilen können, wie sich die Propangasfalsche durch die Explosion zerteilen würde. Es hätte auch blöd hergehen können, dass ein Splitter ein Fahrzeug hätte treffen können. Und die Splitter hätten von der Geschwindigkeit her durchaus ein Auto durchschlagen und jemand töten oder verletzen können.“

Noch 1990 stand der Millionärssohn vor Gericht und wurde mitsamt den Komplizen beschuldigt, ein Mordkomplott gegen seine Eltern ausgeheckt zu haben. Alle drei wurden freigesprochen. „Im Zuge der Vernehmungen hat der […] immer argumentiert, dass er ein Buch schreiben wolle, wie leicht es in Österreich ist, jemanden zu finden, der einen Auftragsmord durchführt. Das war auch seine Argumentation, warum er diesen Vorschuss von 50.000 Schilling schon bezahlt hatte. Aber zur Ausführung sollte das Ganze nie kommen“, so Huber. Auch die Eltern sollen nie daran geglaubt haben.
Der frühe Drogentod des Hauptprotagonisten führte dann dazu, dass Bombencausa endgültig im Sande verlief, so Huber: „Niemand hat sich mehr dafür interessiert.“
Huber selbst war noch bis 2021 im aktiven Dienst. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die Briefbomben des Franz Fuchs. „Die meisten sind beim Öffnen explodiert. Aber die, die wir abfangen konnten, waren eine interessante Herausforderung. Wir hatten für das Entschärfen eine eigene Technik – das Einfrieren in flüssigen Stickstoff bei minus 190 Grad. Dadurch wurde hat die Energiequelle der Briefbombe, eine Batterie, an Leistung verloren und es kam nicht zur Auslösung. Der Brief wurde dazu in den flüssigen Stickstoff hineingelegt und nach einer gewissen Zeit konnten wir das gefahrlos öffnen. Dafür stand allerdings nur ein gewisser Zeitrahmen zur Verfügung, denn die Batterie hat sich langsam wieder erholt. Am Schluss war es dann so, dass der Fuchs eine bis dahin einzigartige Technik verwendet hat, eine röntgenempfindliche Schaltung, sodass beim Durchleuchten mit Röntgenstrahlen die Auslösung erfolgt. Das war erstmalig so – weltweit.“